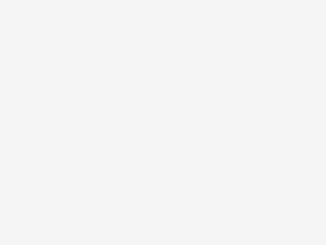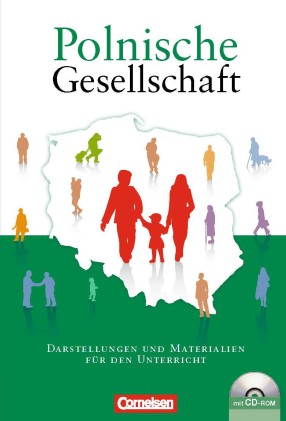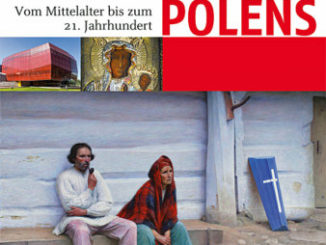Buchtipp Polen
Buchtipp Polen
Gut 20 Jahre nach der politischen Wende zeigen die Autoren des Sammelbands anhand von Beispielen der Jahre 2010 und 2011 wie der Stand der polnischen Erinnerungskultur ist und welche Grundmuster an nationaler Geschichtserzählung es im gesellschaftlichen Diskurs gibt. Dabei treten auch neue Blicke auf kodifizierte Erinnerungsorte zu Tage. Der in der Reihe „Veröffentlichungen des Deutschen Polen Instituts als Band 30 herausgegebene Band wird von Peter Oliver Loew und Christian Prunitsch herausgegeben und ist im Harrassowitz Verlag erschienen.
Der Sammelband stellt die Art, wie in Polen Geschichte erzählt wird wie mit Erinnerungsorte und dem Wandel der Blickweise umgegangen wird, stellen die Autoren an Gedenktagen dar, denn die haben gerade im polnischen Bewusstsein einen festen Platz. Die teils erweiterten Aufsätze gehen auf eine Ringvorlesung der Universitäten Dresden und Mainz im Wintersemester 2010/2011 zurück.
Der Stettiner Historiker Jan M. Piskorski schreibt in seinem Beitrag „Erinnerung als Aussöhnung. Vergangenheit als Quelle von Angst und Hoffnung“ über die Wurzeln der deutsch-polnischen Versöhnungsgeschichte und sieht die Anfänge schon in der judaistischen Tradition der gesellschaftlichen Harmonie durch Versöhnung. Weiter schlägt er den Bogen von der Ilias und der Antike zum Deutschordensstaat. Er belegt, wie in allen Kulturen Versöhnungsrituale, Versöhnungssymbole und Friedenssehnsucht prägend wirkten.
Robert Traba referiert über den „Opferdiskurs als zentraler identitätsstiftender Faktor der polnischen Meistererzählung“. Maßgeblich sei der polnische Erinnerungskalender bis heute von der polnischen Romantik geprägt. Genauso bis heute ist es zentralen identitätsstiftender Faktor in polnischen Meistererzählungen, erklärt Trabe. Was die polnische Romantik anders mache, sei die fehlende staatliche Struktur, das in Polen nicht vorhandene Bürgertum und der bewaffnete Kampf um Souveränität, der Letzteren zum großen Thema machte und die Autoren zu Schriftstellern, die politischen Willen gestalten wollten und nicht etwa Kunst um der Kunst willen.
Hans-Jürgen Bömelburgs Beitrag „Vergessen neben Erinnern. Die brüchige Erinnerung an die Schlacht bei Tannenberg/Grunwald in der deutschen und polnischen Öffentlichkeit“ nimmt sich eines im deutsch-polnischen Geschichtsdialog besonders heiklen Themas an.Wie bedeutend das Thema in Polen noch sei, zeige die üppige Ausgestaltung der 600-Jahrfeier, die in den Medien und der Wissenschaft ein breites Echo fand.
Walter Koschmal zeigt in seinem Beitrag „Der eine und der andere Chopin?“ den größten Komponisten Polens anlässlich des 200. Geburtstags 2010 aus einem ungewohnten Blickwinkel. Anders als Komponisten wie Beethoven ist es das Monolithendasein auf einsamer Höhe sowie die Kombination mit seinem lebenslangen Leiden, das ihn auch noch als Personifizierung des Opfermythos dastehen lässt.
Peter Oliver Loew widmete sich in seinem Beitrag „Paderewski oder Wo liegt Polen. Nation und Erinnerungskultur zwischen dem 19. und dem 21. Jahrhundert“ mit Ignacy Jan Paderewski anlässlich des 150. Geburtstags 2010 und des 60. Todestags 2011 einem weiteren Musiker. Sei Thema sei die musikalische Suche nach der Nation gewesen, meint Loew. Doch auch er nimmt im die Rolle im Pantheon der großen Polen nicht nur als Musiker und Komponist ein, sondern gleichfalls in der Rolle des Politikers. Ohne seine Rolle vor allem in den USA zur1. Weltkriegs, hätte US-Präsident Woodrow Wilson nicht so sehr für ein souveränes Polen eingesetzt.
In Jan Kusbers Aufsatz „Das „Wunder an der Weichsel“ oder Polens Nachbar im Osten“ geht es um das schwierige polnisch-russische Verhältnis, dessen Komplexität der Autor aus Anlass des Jahrestags des „Wunders an der Weichsel“ von 1920 aufarbeitet, aber auch darstellt, wie anders die Sichtweise außerhalb Polens über die Jahrzehnte war. Vor allem in letzter Zeit zeigte sich, dass die Eigenwahrnehmung in Polen noch immer stark durch die Sichtweise Russland=Sowjetunion=Katyn=Ungeliebtes Ostblockdasein = alte Teilungsmacht des 19. Umbrüche vereinfacht wird, die viele Umbrüche des augehenden 20.Jahrhunderts Jahrhunderts nicht wahrnahm.
Heinrich Olschowsky zeigt in seinem Aufsatz „Bertolt Brecht, der Hitler-Stalin-Pakt und Polen“, wie sehr der 2.Weltkrieg dem polnischen kollektiven Gedächtnis bis heute seinen Stempel aufdrückt, und zeigt dies im Spiegel Bert Brechts.
Stefan Garsztecki schreibt über „Warschauer Aufstand und Zweiter Weltkrieg. Polnische Gedächtnispolitik zwischen nationaler Kanonbildung und europäischen Ansätzen“ und analysiert die übergreifenden Erinnerungsstrategien zum Krieg. Dabei stellt er den 2. Weltkrieg in der polnischen Historiografie dar, und den Begriff der Beziehungsgeschichte, die der Historiker Klasu Zernack entwickelte.
Claudia Kraft nimmt sich in ihrem Text „Blickwechsel oder Introspektion? Vertreibungsdebatten vor dem Hintergrund des Gedenkjahres 2010/2011“ des vielschichtigen Debattenkomplexes zu den Vertreibungen an und plädiert für ein dynamisches Verständnis historischer Erinnerung. Claudia Kraft nimmt die vor 20 Jahren geschlossenen Verträge zum Anlass zu untersuchen, ob und wie die Umwälzungen die Deutungen der gewaltsamen Bevölkerungsverschiebungen verantwortet haben.
Hans-Christian Trepte stellt in seiner Arbeit „Zwischen Litauen, Polen, Europa und der Welt: Czes?aw Mi?osz (1911-2004) – ‚Ein Weltreisender‘“ aus Anlass des 100. Geburtstags den Literaturnobelpreisträger Czeslaw Milosz und Aspekte seines Werks vor. Milosz sei ein Weltreisender gewesen uns seit seiner Kindheit ein Wanderer zwischen sehr verschiedenen Welten, der als Heimat eine unzerstörbare Vision geschaffen habe, meint Trepte.
Basil Kerskis Ausatz „Solidarnosc, eine europäische Revolution“ beschließt den Band. Zum 25. Gründungstag stellt Kerski den Beitrag der Solidarnosc zur polnischen, europäischen und universellen Erinnerungskultur dar.
Buchtipp: Polen. Jubiläen und Debatten
Der Leser erhält in dem Sammelband einen wichtigen und viele Aspekte des aktuellen Geschichtsdiskurses und der Erinnerungskultur in Polen umfassenden Überblick, der viele bedeutende Punkte abdeckt. Auch der Nichthistoriker findet in diesem Buch einen leicht fassbaren Einblick in die Grundmuster der Geschichtserzählungen in Polen.
Fazit: Das von Peter Oliver Loew und Christian Prunitsch herausgegebene Buch „Polen. Jubiläen und Debatten“ ist für jeden, der sich mit dem Geschichtsdiskurs in Polen und dem Geschichtsverständnis der Polen interessiert eine sehr empfehlenswerte Lektüre.