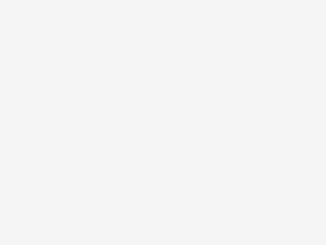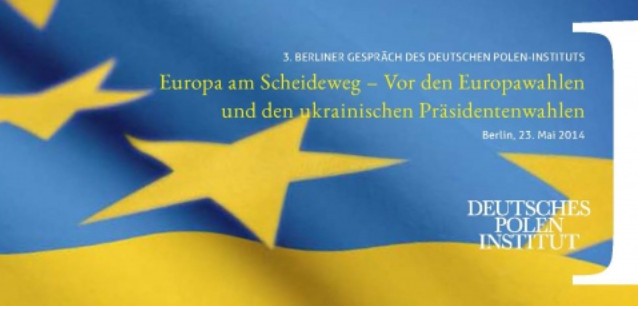Die Polen bewegte in den letzten Tagen das Gedenken an die Opfer des polnisch-ukrainischen Konflikts in Wolhynien und Ostgalizien. Zwischen dem Februar 1943 bis zum Februar 1944 war es zu entsetzlichen Massakern von ukrainischen Nationalisten an der polnischen Zivilbevölkerung in den bis Kriegsbeginn polnischen Ostgebieten führten.
Ihren Höhepunkt hatten die Massaker im Sommer 1943 am „Blutigen Sonntag“, dem 11. Juli 1943. Dmytro Klijatschkiwki, der Befehlshaber der UPA-Nord (Ukrainische Aufstandsarmee, der militärische Teil der Organisation Ukrainischer Nationalisten, der zeitweise mit der deutschen Besatzung kollaborierte) j hatte befohlen, alle männlichen Polen in diesem Gebiet zu liquidieren, denn ein ethnisch „reines“ Wolhynien wäre ohne polnische Bevölkerung leichter zu annektieren gewesen. Allein in Wolhynien schätzen Historiker die Zahl der polnischen Opfer auf mindestens 50-60.000, in der ganzen Ukraine dürften es über 100.000 gewesen sein. Die deutsche Besatzungstruppen schritten nicht ein, sie duldeten die Verbrechen, zuweilen beförderte man sie sogar.
Untergrundkämpfer der Polnischen Heimatarmee (Armia Krajowa) AK versuchten ihre Landsleute zu schützen, es kam auch zu Vergeltungsaktionen an Ukrainern. Diesen Aktionen fielen nach Einschätzung von Historikern mindestens 10.000 Ukrainer zum Opfer.
Zum 70. Jahrestag der Massaker verabschiedete das polnische Parlament eine Entschließung, die die Massaker von Wolhynien und Ostgalizien als ethnische Säuberungen bezeichnet, die Merkmale eines Völkermords aufweisen. Am 11. Juli wurden in Polen der Opfer gedacht. Bei der offiziellen Trauerfeier bezeichnete der polnische Präsident Bronislaw Komorowski die Massaker als eine der schmerklichsten Erfahrungen der Polen im Zweiten Weltkrieg. Am Sonntag reiste Komorowski in die Ukraine zu einer Gedenkfeier.
Bis heute belastet vor allem der „Blutige Sonntag“ die Beziehungen zwischen der Ukraine und Polen. Polnische Bewohner des Gebiets und Opferfamilien mahnen immer wieder an, die Massaker – viele Polen wurden in den Kirchen ihrer Heimatorte eingesperrt und bei lebendigem Leib verbrannnt – als Völkermord einzustufen.
Staatspräsident Bronislaw Komorowski rief am Sonntag im ehemals polnischen Ort Luck/Luzk in der Westukraine zur Versöhnung zwischen Polen und Ukrainern auf. Man sei gemeinsam da, Polen und Ukrainer erklärte Komorowski in der katholischen Kathedrale von Luzk. Es gäbe keine Rechtfertigung für solche Gewalttaten, denn „Brudermord sei immer schrecklich. Auch der Wunsch nach Freiheit und Souveränität rechtfertige keine ethnischen Säuberungen, fügte der polnische Präsident an. Dass es in der Ukraine noch immer zu wenig Kenntnisse über die Vorgänge vor 70 Jahren gibt, zeigte sich vor der Gedenkfeier, als Komorowski von einem ukrainischen Nationalisten mit einem Ei beworfen wurde.
Dokumentation zu den Massakern von Wolhynien:
Weitere Artikel der Serie
- Der polnische Untergrundstaat 1939-1945 (14. September 2015)
- Dossier: Der Zweite Weltkrieg und Polen (25. August 2014)
- Jan Karski – Diplomat und Widerstandskämpfer (10. Februar 2014)
- Holocaust: Die deutsche Ordnungspolizei, der mordende Freund und Helfer (17. Juli 2013)
- Polen: Gedenkfeiern zum 70. Jahrestag des Massakers von Wolhynien (15. Juli 2013)
- Vor 70 Jahren: Beginn des Aufstands im Warschauer Ghetto (19. April 2013)
- Polen: Kritik am ZDF-Dreiteiler „Unsere Mütter, unsere Väter“ (27. März 2013)
- Holocaust: Poklosie-Ein Film rüttelt am Geschichtsbild der Polen (27. Januar 2013)
- Warschauer Getto: Am 22.Juli 2012 beginnt die Auflösung (23. Juli 2012)
- Polen: Neues Buch von Jan Tomasz Gross erregt die Gemüter (11. März 2011)
- Polen: Wielun, der vergessene Kriegsbeginn (1. September 2010)
- Der Warschauer Aufstand 1944 (5. August 2010)
- Marek Edelmann ist tot (5. Oktober 2009)
- Teufelswerk: Der Hitler-Stalin-Pakt (1. September 2009)
- Die polnischen Opfer (1. September 2009)
- Polen im 2. Weltkrieg (1. September 2009)
- Der 1.September 1939 (1. September 2009)
- Gehalten bis zum letzen Tag – Das KZ Stutthof (13. Januar 2009)
- Auschwitz – Grauen ohne Worte (2. Januar 2009)
- Zum Scheitern verurteilt–Die Freie Stadt Danzig (30. Dezember 2008)